 |
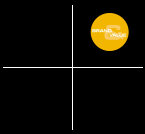 |
 |
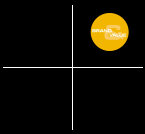 |
| Texte & Memos |
|---|
„A penny for your thoughts“
Welcher Manager hat dies nicht schon gedacht, wenn er über seine Kunden, Käufer oder Zielgruppen nachgedacht hat – vor allem, wenn er erfolgreicher sein will.
Aber da ist gar nicht so leicht heran zu kommen, an die Gedanken!
- Sicher, man kann es mit Marktforschung versuchen, aber die bleibt im Bewussten „hängen“ (Auch wenn manche Marktforscher meinen, sie könnten die unbewussten Gedanken aufzeigen)
- Sicher, man kann sich selbst beobachten, aber das ist zumeist nicht so ganz repräsentativ (und verbleibt auch im Bewussten)
- Sicher, man kann sich auch vertrauensvoll an seinen Haus-Berater wenden, der wird ja nicht nur überall gebraucht, sondern kennt sich auch mit allem bestens aus
- Oder man wendet sich an jemanden. der sich tatsächlich damit auskennt, nämlich uns!
Überheblich? Nicht wirklich!
Wir verfügen – weltweit unique – über ein Computer-Verfahren, das zu irgendwelchen Begriffen aufzeigt, was gleichzeitig mit- und weitergedacht wird (technisch: die Assoziationen).
Diese sind ein unbewusster, quasi automatischer Prozess im Kopf von Menschen und bestimmen, was wie gedacht und verstanden wird.
Ja und?
Ganz einfach: Wenn Sie wissen, was ihre Zielgruppe wie zu Ihren Produkten / Dienstleistungen denkt, dann können Sie diese deutlich wirksamer positionieren, die Kaufrelevanz Ihrer Produkte wirksam steigern.
Oder den Markt funktional verstehen. Oder die Stärken und Schwächen Ihrer Wettbewerber besser erfassen, als diese selbst es könnten.
Und, wen interessiert das?
Zum Beispiel eine politische Partei, ein weltweit tätiges Großunternehmen der Logistik, ein Damen-Miederwarengeschäft (der „kleinste“ Kunde), diverse Markenartikler und „last but not the least“ das Malik Management Zentrum St. Gallen (wohl die beste Unternehmensberatung, aus meiner Sicht)
Ist das schon alles? Nein:
Natürlich erstreckt sich unser Angebot nicht nur auf die kaufrelevante Profilierung von Produkten und Dienstleistungen: Ein wichtiger zweiter Bereich ist die Nutzung komplexer Messverfahrens. Dadurch können wir Produktleistungen (etc.) exakt messen und die intern gemessene Produktleistung der extern gemessenen gegenüberstellen (Portfolio).
Durch die Anwendung der modernen „fuzzy logic“ (keine Angst: Der Autofokus Ihrer Kamera basiert zum Beispiel auf „fuzzy logic“) können die Ergebnisse in einer „Portfolio-Hierarchie“ einzelner Unternehmensbereiche leicht verständlich dargestellt werden.
Somit ist es möglich, viele der oftmals als „weich“ bezeichneten Faktoren in beispielsweise
- Sortimentsgestaltung
- Dachmarkengestaltung
- Einkaufsverhalten
- Qualitätsmanagement Prozesse usw.
„wie mit dem Zollstock gemessen“ einfließen zu lassen.
Ok – und was ist die schlechte Nachricht??
Meistens „chargen“ wir mehr als einen Penny!
Dr. Udo E. Marten
Geschäftsführender Gesellschafter
der
Dr. Marten brand & value GmbH
Psychologische Untersuchungen der Universität Bremen in Zusammenarbeit mit der „Dr. Marten brand & value GmbH“, Bremen, liefern verblüffende Erkenntnisse zum Kaufverhalten von Konsumenten.
Im Gegensatz zur klassischen Marktforschung, die Konsumenteneinstellungen oft über Profile definiert, führt eine heuristische Betrachtung der Kaufentscheidung zu wesentlich differenzierteren Aussagen über kaufrelevante Aspekte.
Untersuchungen der heuristischen Kaufenscheidungsforschung haben erstmals gezeigt, dass Konsumenten sogar oftmals anders entscheiden, als nach den mathematisch ermittelten Präferenzen der herkömmlichen Analysen angenommen.
Was zur Folge hat, dass die üblichen Stärken-/Schwächen-Analysen von Marken oftmals falsch im Hinblick auf Kaufrelevanz sind. Selbst die „Stars“ unter den Marken werden aus ganz anderen Gründen gekauft als die klassische Marktforschung nahelegt. Somit laufen diese Marken Gefahr, an falscher Stelle profiliert zu sein und schließlich „im Regal“ selbst gegen No-Names zu unterliegen.
Zudem ist deutlich geworden, dass Konsumenten im Alltag keine „Probleme“ bezüglich ihrer Kaufentscheidungen besitzen. Die letztendliche Wahl wird auch bei langen Entscheidungssequenzen nur aufgrund sehr weniger Aspekte getroffen.
Diese Ergebnisse gelten ausnahmslos in allen bisher untersuchten Produktbereichen und sprechen heuristischen Auswahlprozessen beim Kauf die wichtigste Bedeutung zu.
Praktische Relevanz gewinnen diese Ergebnisse, da die eigentlich kaufrelevanten Aspekte oft unbeachtet bleiben. Unter Kenntnis dieser kaufrelevanten Heuristiken ergeben sich aber entscheidende strategische Vorteile einer integrierten Markenführung.
Beste Aussichten auf Erfolg haben hierbei Methoden, die die assoziativen Strukturen der Verbraucher nutzen, um kaufrelevante Aspekte zu integrieren. Wichtig ist hierbei die indirekte Erzeugung von Kaufrelevanz, da diese sich faktisch im Urteilsverhalten niederschlägt.
Durch die geschickte Nutzung der hierfür wesentlichen Assoziation gelingt es, die Marke hinsichtlich jener Aspekte, die dazu führen, dass die Marke verstärkt gekauft wird, anzureichern.
Da solche assoziativen Verfahren in der Praxis nicht mittels üblicher Techniken von Konsumenten zu erfahren sind („unbezahlbar“), bedienen sich Experten hierfür Computer-gestützter assoziativer Verfahren, wie des „Profilers“ der „Dr. Marten brand & value GmbH“.
Dr. Udo E. Marten
Feb 2004
Kontakt über: www.brand-a-value.com
Die Intuitive Alleinstellung
Marketing ist ein schwieriges Unterfangen: Dreht es sich doch darum, den Konsumenten immer neu von der Eigenständigkeit und Überlegenheit des eigenen Angebotes zu überzeugen. Ihn zu interessieren, zu involvieren und zum Kauf zu bewegen.
Die Möglichkeiten hierzu sind natürlich vielfältig.
Und doch zeichnen sich bestimmte Regelmäßigkeiten in der werblichen Ansprache des Konsumenten ab:
Zu Beginn der Kommunikation, ca. in den 1950er Jahren, reichte es aus, die wesentlichen und alleinstellenden Argumente zu übermitteln. „Weißer geht’s nicht“, „Jetzt hast Du ein schlechtes Gewissen!“ oder „der Kaffee-Experte“ sind nur ein paar spätere Beispiele für diese Art der Konsumentenansprache.In den späten 1970er und mit Beginn der 1980er Jahre reichte dies so nicht mehr aus: Die Emotionalität wurde entdeckt und mit ihr die Wichtigkeit der gezielten emotionalen Einbettung der Botschaften. Immer mehr Produkte leisteten in ihren Bereichen sehr ähnliche Versprechen und eine alleinige Differenzierung über eine ähnliche Leistung ist halt nicht machbar. Allerdings gibt es nur begrenzte Möglichkeiten der emotionalen Anreicherung (vgl. unten stehende Tabelle 1), die ja zudem auch mit der Produktleistung verbunden sein muss, und eine Mehr-Leistung für das Produkt enthält, wie etwa „Die ‚Überhöhung’ der schönsten Stunden“.
Eine weitere Einschränkung ist die Begrenzung auf positive Qualitäten, denn es will wohl niemand sein Produkt mit negativen Komponenten belasten.
Insofern scheint auch diese Möglichkeit der Markendifferenzierung allmählich ausgereizt und es stellt sich die Frage: „Quo vadis, Marketing?“, denn es sind wiederum circa 30 Jahre vergangen.
Natürlich gibt es mehrere Ansätze / Versuche, den Konsumenten wirksamer zu überzeugen; hier nur zwei derzeit populäre: - „Consumer Insights“ sind hier eine feste Größe. Eine beste Übersetzung scheint „Einsichten / Erkenntnisse über Konsumenten“ zu sein.
Selbstverständlich ist es gut und richtig, wenn sich das Marketing gezielt und differenziert mit seinen Produktverwendern oder auch Nicht-Verwendern auseinandersetzt. Dies ist auch nicht wirklich neu. Allerdings bestehen hier beispielhaft aufgeführt mehrere Risiken:
Zum Ersten wird man oftmals eben nur Mängel feststellen, wie etwa dass die Windel nach mehrstündigem Tragen deutliche Spuren hinterlässt, oder die Handhabung des Produktes nicht der Vorstellung der Entwicklungsingenieure entspricht.
Zum Zweiten werden durch eine nicht fundierte Vorgehensweise bei der beobachtenden Datenerhebung Beobachtungsfehlern „Tür und Tor geöffnet“: Man sieht nicht die Realität, sondern interpretiert die Wahrnehmung in seinem eigenen Verständnis. Das kann beispielsweise sehr schnell zu so genannten „sich selbst erfüllenden Prophezeiungen“ führen - fern ab einer wirklichen Erkenntnis.
Zum Dritten besteht die Gefahr, einer sinnlosen schablonenhaften Nutzung der Idee der „Consumer Insight“. Nur weil es gefordert wird, formuliert man dann eben ein „Insight“. Was ist denn die Relevanz der Erkenntnis, dass ich „als attraktiver Mensch geschätzt werden möchte“ - und welches Produkt kann diese Einsicht sinnvoll nutzen? Mode, Kosmetik oder Alkohol? Letzteres wohl eher nur in einer Selbst-Fehl-Einschätzung. Schon die Aufzählung dieser wenigen Aspekte verdeutlicht wohl recht schnell, die Sinnhaftigkeit des Vorgehens.
- Unter der Bezeichnung „neuronales Marketing“ ist eine Klasse von Verfahren auf dem Markt, die direkte Einsicht „in die Hirntätigkeit“ verspricht - und dies auch auf Basis spezifischer Aktivierungen zeigt.
Als problematisch sehen wir hier insbesondere, dass all diese Verfahren nicht konstruktiv, sondern reaktiv sind. Man kann gut die interne Reaktion auf Vorlagen / Testmaterial / Reize erfassen und bestimmen, jedoch weiß man anschließend nur, ob eine Vorlage gut ist oder nicht. Wenn sie gut ist: Prima; wenn nicht? Dann erstellt man eben die nächste Vorlage und prüft diese wiederum ab. Bei der Vielzahl an möglichen Vorlagen ergibt dies zumindest einen stabilen „Auftragsfluss“ für die durchführenden Institute.
Ein völlig anderer und sehr viel versprechender Ansatz ist die Entwicklung der „Intuitiven Alleinstellung“. Diese wird durch die Einbeziehung des intuitiven Wissens, manche sprechen hier auch vom „Unbewussten“, erreicht.
Der Mensch denkt wie er will, nicht wie wir es wollen: Jeder Mensch denkt in den ihm eigenen Bahnen und Verbindungen. Dies ist ein automatischer Prozess, der unbewusst „im Kopf“ abläuft.
So wissen wir zum Beispiel was wir sagen wollen, die konkrete „Wortwahl“, also „das gesprochenen Wort“ geschieht aber unbewusst und automatisch im Kopf. Ganz deutlich wird dies, wenn man an die Stelle gekommen ist „was wollte ich nun gleich doch wieder sagen?“ usw.
Andererseits sind die „Bahnen“ im Kopf vieler Menschen sehr ähnlich - sonst könnten wir gar nicht miteinander sprechen: Man würde nach jedem zweiten Wort fragen „wie meinst Du das?“.
Wenn man nun in der Lage ist, diese automatischen, oder auch unbewussten Prozesse und Gedanken für die Marketingarbeit zu kennen, ist man in der Lage, Produkte oder Dienstleistungen so zu positionieren, dass sie unmittelbar verstanden werden, „Risiko frei“.
Diese Art der Marketingarbeit nennt b&v die Erreichung der „Intuitiven Alleinstellung“.
Wir wissen, dass die argumentative und die emotionale Komponente durch eine unmittelbar wirksame Eigenschaft ergänzt werden müssen, um zur „Intuitiven Alleinstellung“ zu gelangen.
Es ist wichtig zu wissen, wie Menschen über Produkte und Dienstleistungen denken, welche Kontexte sich ihnen öffnen und welche Automatismen im Kopf ablaufen - oder technisch ausgedrückt: Was zu einem Produkt, einem Produktfeld und den Produkten der Wettbewerber assoziiert wird.
Hierbei sind es gerade die ungewöhnlichen, nicht alltäglichen Assoziationen, die spannend für Produkte sind, die unmittelbar wirksam sind. Auch dieses Wortpaar „unmittelbar wirksam“ ist eine solche zwar ungewöhnliche, aber direkt verstehbare Assoziation.
Die „Dr. Marten brand & value GmbH“ (b&v) befasst sich seit Jahren mit diesem Phänomen und hat mit ihrer Methode, dem „Profiling“, ein Verfahren entwickelt, das es gestattet, diese intuitive Komponente konstruktiv in die Marketingarbeit einzubeziehen.
Kernergebnisse der bisherigen „Profiling“-Projekte sind echte Evolution, nicht Revolution, neue Vermarktungsansätze und die unmittelbar wirksame Zielgruppenansprache; sei es in der zielgerichteten Wortwahl des Unternehmens oder auch in der Markendifferenzierung. In der Positionierung, wie auch in der Kommunikation. Inhaltlicher Schwerpunkt ist hierbei jeweils zunächst, die gedanklichen „Trampelpfade“ zu öffnen, um zielgerichtet und effizient neue An- und Einsichten für die erfolgreiche Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen zu entwickeln
„Faszinierend einfach - einfach faszinierend“ wie ein Projektteilnehmer sagte, respektive: „Klondike“ für das Marketing, denn wenn man alles Denkbare hat, braucht man „die Nuggets“ nur heraus zu finden
Dr. Udo E. Marten
Hassendorf, 25 Mai 2011
Checkliste der „Intuitiven Alleinstellung“
Die „Intuitive Alleinstellung“ erweitert die argumentative und emotionale Komponente eines Produktes (einer Dienstleistung) um die unmittelbar wirksame, intuitive und somit Kauf auslösende Komponente. Eine einfache Checkliste ist oftmals der erste Schritt zu mehr Markterfolg:
1. ist der Produktvorteil
• einfach
• einfach zu verstehen
• ungewöhnlich / ungewöhnlich formuliert
• mehr als eine Argumentation
• mehr als ein gutes Gefühl
2. entspricht Ihr Produktvorteil einer Kernmotivation (der Zielgruppe)
3. werden Sie um diesen Vorteil in der „Peer-Group“ beneidet
4. erzeugt Ihr Produktvorteil
• „ein Kribbeln“
• den „muss-ich-haben-Reflex“
Mai 2011
Autor: PD Dr. Michael Zaus, Dr. U. E. Marten
Kapitel: Turning Knowledge into Cash – Best Practices der Wissensumwandlung
Datum: 30.10.2002
Turning Knowledge into Cash – Best Practices der Wissensumwandlung
PD Dr. Michael Zaus Dr. Udo E. Marten
Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg Brand & Value GmbH Bremen
1. Einleitung
Wissensmanagement und Wissensumwandlung haben zwei wesentliche Dinge gemeinsam. Beide können einerseits als Metaphern, andererseits als dynamische Prozesse aufgefasst werden. Als Metapher beinhaltet Wissensmanagement die Vorantreibung, Leitung und Anleitung impliziten, expliziten und prozessualen Wissens, während Wissensumwandlung metaphorisch auf die Umgestaltung, Transformation und den Transfer von Wissen ausgerichtet ist, um Wissenskapital mit entsprechenden Wertschöpfungen zu mehren. Weitaus wichtiger ist jedoch die Prozessperspektive, da es sich bei beiden um dynamische Prozesse handelt, in welchen zielbewusst und ergebnisorientiert gearbeitet wird. Bei beiden geht es darum, das Synergieprinzip von Effektivität und Effizienz einzulösen. In aller Klarheit fordert dieses Prinzip, die richtigen Dinge zu machen und die Dinge richtig zu machen,. Mit anderen Worten: Synergy cuts the work in half. Auf diese Weise werden Effektivität und Effizienz nicht mehr disparat als zwei Seiten ein und derselben Münze behandelt, sondern kommen als synergetische Einheit zum Einsatz. Wenn dies auf der Grundlage adäquaten Handlungswissens gelingt, wird jeglicher Arbeitsaufwand um bis zu 50% reduziert, womit uns das Erste der First Principles für ,,Turning Knowledge into Cash’’ vorliegt. Weitere First Principles dieser Art folgen im Verlauf unserer weiteren Darlegungen zu Wissensmanagement und Wissensumwandlung.
In Abschnitt 2 werden zunächst zwei Konzeptionen zum Wissensmanagement vorgestellt, um der Wissensumwandlung eine Positionierung im Wissensmanagement zu verleihen. Dies betrifft zum einen die Konzeption des Wissensmanagements als lernende Organisation, die teilweise aus dem theoretischen und praktischen Bezugsrahmen lernender Organisationen und teilweise aus davon unabhängig entwickelten Modellen zum Wissensmanagement abgeleitet wurde (Senge 1994, Probst et al.. 1997, Nonaka & Takeuchi 1997, Sterman 2000, Zaus 1999, 2002a). Zum anderen betrifft es die Konzeption des Wissensmanagements als Community of Learning and Practice, die gänzlich anders aufgebaut ist als das Wissensmanagement als lernende Organisation und sich auch hinsichtlich ihrer Zielsetzungen bezüglich des Austausches von Handlungskompetenzen unterscheidet (Wenger 1999, Schönherr 2002, Kim 2000). So verschieden diese beiden und andere Konzeptionen auch sein mögen, in einem Punkt überschneiden sich alle unabhängig von ihren Architekturen, und das ist die Wissensumwandlung. An ihren Methoden und Techniken, die geradezu eine Börse von Best Practices konstituieren, kommt kein praktisch arbeitender Wissensmanager und kein auf substanziellen Output ausgerichtetes Wissensmanagement-Team vorbei, weil die Wissensumwandlung der Wachstumsmotor für Wissenskapital und Wertschöpfung ist. Turning Knowledge into Cash bedeutet, Wissen einen monetären, materiellen oder ideellen Austauschwert zu verleihen. Dieser Prozess beginnt mit obigem Synergieprinzip, das durch Richters Wertschöpfungsprinzip noch ergänzt werden kann (Richter 2001). Als First Principle besagt es: Wissende handeln klug. Großer Gewinn G. Unwissende handeln dumm. Kleiner Gewinn g. Wertschöpfung durch Wissen: G – g . Respice finem im Falle zu vieler Unwissender!
In Abschnitt 3 soll daher die Wissensumwandlung als relativ eigenständiges Modul dargelegt werden. Als Ausgangspunkt dient uns dazu Nonaka & Takeuchis Theorie der Wissensschaffung über die Stadien der Sozialisation, Externalisierung, Kombination und Internalisierung. Was diese Theorie so attraktiv macht, sind ihre evolutionsstrategischen Implikationen, die Nonaka und Takeuchi zwar nicht explizit machten, die aber jeder schnell erkennen wird, insofern er sich mit Wachstumsprozessen aus evolutionärer Sicht oder mit evolutionsgenetischen Berechnungsverfahren auseinander gesetzt hat. Aus Platzgründen können diese Aspekte nur knapp eingebunden werden. Ein größeres Gewicht verleihen wir deswegen den Methoden und Techniken, die im Rahmen der Wissensumwandlung zur Anwendung kommen können und als Best Practices anerkannt sind. Wir hoffen dadurch, unseren Lesern einen Einblick in das Wissensmanagement zu eröffnen, wie es aus den Perspektiven der Witschafts-, Organisations- und Kognitionspsychologie gesehen wird. Naturgemäß wird dabei auch das vernetzte Denken mit seinen speziellen Methoden und Techniken eine zentrale Rolle spielen, zumal Lernen, Gedächtnis und Denken als dialektische Einheit im herkömmlichen Wissensmanagement nicht den Platz einnimmt, der ihr als Motor zur Wissenserzeugung gebührt.
In Abschnitt 4 erfolgt eine zusammenfassende Bewertung der vorgestellten Best Practices und ein kurzer Ausblick auf Weiterentwicklungen, die wir im Rahmen der Wissensumwandlung für wünschenswert und erfolgversprechend halten.
2. Konzeptionen zum Wissensmanagements2.1 Stärken potenzieren, Schwächen eliminieren
Nahezu jede der in jüngster Zeit propagierten Wissensmanagementkonzeptionen weist ihre eigenen charakteristischen Eckpfeiler auf, die dann als tragendes Gerüst den Aufbau einer mehr oder weniger differenzierten Architektur ermöglichen (Lehner 2000, Probst et al.1997). Welche Architektur des Wissensmanagements bevorzugenswert erscheint, ist in Fachkreisen im Vordergrund der praktischen Realisierbarkeit indessen heftig umstritten. Insoweit die Bevorzugung ,,angeordnet’’ wird, hängt die Wahl natürlich nur davon ab, ``at whose feet we sit, and on whose shoulders we stand’’. An Stelle einer lagertheoretischen Position bevorzugen wir die Position der Stärkenpotenzierung, da sie hierdurch zu einer Schwächenelimination beiträgt. Jede Konzeption, ob Community of Practice, Community of Learning oder die des Wissensmanagements als Lernende Organisation, besitzt ihre Stärken und Schwächen, die man erkennen muss. Nur so kann daraus eine noch stärkere Konzeption entwickelt werden oder bewährte Vorgehensweisen gegenseitig übernommen werden. Da es hierzu aufgrund konfligierender Interessen keinen Königsweg gibt und die Lösung noch aussteht, stellen wir zwei Konzeptionen in den Vordergrund, in welchen die Wissensumwandlung als Motor zur Wissensschaffung und Wertschöpfung von vergleichbarem Interesse ist. Die erste Konzeption betrifft Wissensmanagement als Lernende Organisation, in welchem das durch individuelle und kollektive Fähig- und Fertigkeiten hervorgebrachte Wissen als Unternehmensgut angelegt und durch eine Vernetzung seiner Eckpfeiler gewinnbringend nutzbar gemacht werden kann (Zaus 2002, Senge et al. 1999, Sterman 2000). Nicht in Ergänzung dazu, sondern vielmehr als unabhängig entwickelte Konzeption betrifft dies zum zweiten das Wissensmanagement als Community of Learning and Practice, das sich in seiner Funktion sowie in seiner Mitgliedschafts- und Organisationsstruktur von lernenden Organisationen weitgehend unterscheidet (Lehner 2000, Schönherr 2002, Wenger 1999).
2.2 Wissensmanagements als Lernende Organisation (WIMALO)
Vom Standpunkt der Wirtschafts-, Organisations- und Kognitionspsychologie ist Wissensmanagement als lernende Organisation keine Dokumentenverwaltung, sondern ein Prozess intelligenten Organisierens. Was es dabei zu organisieren gilt, ist die Koordination von Denkprozessen, die sich in den Köpfen von Mitgliedern in Arbeits- oder Projektteams abspielen, und zwar hinsichtlich
1) Wissenserwerb: Personal Mastery zwecks Erzielung rapider Wissensakquisition und –formation
2) Wissenserzeugung: Methoden und Techniken vernetzten Denkens produktiv ein- und umsetzen
3) Wissensrepräsentation: Mentale Modelle i.w.S. visuell und kartographisch transparent machen
4) Wissensumwandlung: Team-Lernen zwecks effektivem und effizientem Wissenstransfer
5) Wissensnutzung: Unternehmensziele durch angewandte Wissensvermarktung erzielen
Das im Zuge dieser fünf miteinander vernetzten Eckpfeiler produzierte Wissen soll in Form von Wissensvermögensständen (knowledge assets) als Wissenskapital in eine Wissensbank einfließen, um es gezielten und zugriffsberechtigten Personen im Unternehmen verfügbar zu machen.
2.2.1 First Principles
Worauf kommt es hier primär an, welche First Principles müssen hier greifen? Es kommt in erster Linie auf einen optimalen Wissenszugriff und Kosteneffiziens an, so dass die richtige Person mit richtiger Information und richtigem Wissen in der richtigen Form zur richtigen Zeit zum Treffen richtiger Entscheidungen mit möglichst hohem Gewinn unterstützt wird. Als First Principles greifen hier das Paretoprinzip und Ockham’s Sparsamkeitsprinzip, nach welchen der Nutzen eines Arbeitsergebnisses durch den geringst möglichen Arbeitsaufwand und mit möglichst wenigen Mitteln zu maximieren ist. Beide Prinzipien beinhalten zudem das Maupertiusprinzip, um zur Zielerreichung den Weg des geringsten Widerstandes gehen zu können und nicht im Chaos verteilter und kompliziert vernetzter ``User Support Services’’ zu versinken. Zusammengenommen gewährleistet die Einhaltung aller drei Prinzipien, dass Zeit-, Material-, Energie- und Arbeitskräfteeinsatz minimierbar werden, womit wir drei weitere First Principles für ,,Turning Knowledge into Cash’’ herausgestellt haben.
Leser, die mit dem Bezugsrahmen lernender Organisationen sensu Senge (1994, 1996) vertraut sind, werden erkennen, dass die hier gewählten Eckpfeiler voll mit denen lernender Organisationen harmonieren, denn Wissenserwerb steht mit Personal Mastery und Wissensrepräsentation mit Mentalen Modellen in Verbindung, während Wissensumwandlung mit Team-Lernen und Wissensnutzung mit Gemeinsamen Visionen in Verbindung stehen. Die 5.Disziplin – das systemische Denken – wird indessen durch den Eckpfeiler Wissenserzeugung und den dazugehörigen Methoden und Techniken vernetzten Denkens erheblich erweitert und zu einem mächtigen Werkzeug ausgebaut, das die Eckpfeiler 1 und 3 bis 5 zu einem voll vernetzten System integriert (Zaus 2002a, 2002b). Die Gesamtstruktur des WIMALO in seinen Einzelheiten herauszuarbeiten würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, so dass wir uns auf eine kurze Charakterisierung der Funktionen jedes Eckpfeilers beschränken.
2.2.2 Wissenserwerb
Der Eckpfeiler zum Wissenserwerb beinhaltet die Verfügbarmachung von Werkzeugen, die das Lernen zu lernen massiv unterstützen. Erfahrungsgemäß darf man nämlich nicht von der Annahme ausgehen, dass die in das WM einbezogenen Mitarbeiter von vornherein die Techniken beherrschen, mit welchen Wissen in systematischer Weise erworben und bedeutungsvoll visualisiert und kartographiert werden kann. Dies bezieht sich auf explizites Fakten- und Sachverhaltswissen, auf implizites Handlungswissen in Bezug auf unternehmensrelevante Workflows, auf Kausalwissen über die Wirkungen und Rückwirkungen komplexer Ursache-Wirkungszusammenhänge, und auf systemtheoretisches Wissen über Business Dynamics bezüglich Wachstumsmotoren. Zu den angesprochenen Werkzeugen zählen insbesondere Techniken der modernen Wissenskartographierung, in deren Rahmen spezifisches Wissen sichtbar, verständlich, nachvollziehbar, austauschbar und nutzbar gemacht wird. Hierzu zählen das Concept Mapping (Fakten- und Sachverhaltswissen), das Decision- & Process Mapping (Einzelne, parallele und interaktiv verschachtelte Workflows), das Fuzzy Cognitive Mapping (Mehrwertige Kausalnetzwerke und qualitative Prädiktorsysteme), das Causal Loop Mapping (Kausale Rückkopplungsnetzwerke), sowie das Stock & Flow Mapping (Wachstumsmotoren über rückgekoppelte Bestands- und Flußgrössen), um nur einige zu nennen. Lernen zu lernen erfordert jedoch auch effizient Denken und Umdenken zu lernen, zumal Lernen, Gedächtnis und Denken eine dialektische Einheit bilden, in der das eine schwer ohne das andere auskommt. Dies bringt uns zum zweiten und integrierenden Eckpfeiler, in welchem vernetztes Denken eine zentrale Rolle einnimmt.
2.2.3 Wissenserzeugung
Im Mittelpunkt des Eckpfeilers Wissenserzeugung steht das Denken und die Herausforderungen an neue Denktechniken, die unter den Schlüsselbegriff des vernetzten Denkens fallen (Richmond 1993, Sterman 2000, Vester 2000, Zaus 1999, 2002a). Insgesamt schließt es sowohl das mehr qualitativ orientierte systemische Denken als auch das mehr quantitativ orientierte systemtheoretische Denken ein. Auf diesem allgemeinen Niveau darf man jedoch nicht stehen bleiben. Konkret fallen unter das vernetzte Denken mindestens 10 Denktechniken, die sich adäquat definieren lassen, an konkreten Fähigkeiten festgemacht werden können und daher auch empirisch angemessen testbar sind. Zu nennen sind hier (1) das kreative Denken, (2) das visuelle Denken (3) das konzeptuelle Denken, (4) das prozedurale Denken, (5), das nichtlineare Kausaldenken, (6) das fuzzy logische Denken, (7) das generische Denken, (8) das dynamische Denken, (9) das strukturelle Denken, und das (10) funktionale Denken. Im herkömmlichen Wissensmanagement, das weder die neuesten Entwicklungen der kognitiven Psychologie noch die der Cognitive Neuroscience berücksichtigt, kommt das Denken als instrumenteller Produktivfaktor entschieden zu kurz, obwohl es der Motor für substanzielle Wissenserzeugung ist (Zaus 2002a, 2002b). Hinzu kommt, dass alle unter dem Eckpfeiler Wissenserwerb genannten Wissenskartierungstechniken die hier genannten Denktechniken voraussetzen und im Rahmen der Wissensumwandlung professionell umzusetzen sind.
2.2.4 Wissensrepräsentation
Der Eckpfeiler Wissensrepräsentation umfasst als Wissensbank alle tatsächlich verfügbaren Objekte für den Wissenszugriff. Hierzu zählen nicht nur die im Rahmen des Wissenserwerbs und der Wissenserzeugung produzierten Resultate in Form wohldokumentierter Schemata, Metaphern. Analogien und mentaler Modelle, sondern auch die aus der Wissenskartographierung hervorgehenden Wissenskarten, zum Beispiel Mind Maps (Brainstorming), Concept Maps (Konzeptuelle Navigations- und Begriffsnetzwerke), Decision & Process Maps (Workflows und Handlungsablaufpläne), Causal Loop Maps (Kausalkarten), Fuzzy Cognitive Maps (Kausalnetzwerke), Stock & Flow Maps (Projekt- und Wachstumsnetzwerke), Functional Flow Maps (Berechnungsnetzwerke) sowie übergreifende und koordinierende Hypermaps, Hyperwebs und Hybride Maps, die aus speziellen Mappingtechniken hervorgegangen sind. Alle hier genannten Techniken werden derzeitig von den Autoren in kommerziellen und wissenschaftlichen Projekten erfolgreich eingesetzt (Marten & Zaus 2002, Zaus 2002a).
2.2.5 Wissensumwandlung
Den vierten Eckpfeiler bildet die Wissensumwandlung, auf die wir unter Abschnitt 4 noch gesondert im Kontext von Best Practices ausführlicher eingehen. Hier sei hervorgehoben, dass unser Ausgangspunkt der Ansatz von Nonaka & Takeuchi (1997) ist, nach welchem die kommunikative Interaktion zwischen den Mitgliedern eines Unternehmens zwecks Austausch expliziten, impliziten und prozessualen Wissens der Schlüssel zum Wachstum von Wissenskapital ist. Dieser Interaktionsprozess setzt allerdings Metawissen darüber voraus, wie Wissen gegliedert und strukturiert werden kann, da explizites und implizites Wissen nur die Pole eines Wissenskontinuums sind. Eine der Hauptfunktionen der Wissensumwandlung ist es, über die Prozesse der Sozialisation, Externalisierung, Rekombination und Internalisierung Wissenstransfer zu erzeugen, neues Wissen zu schaffen, Wissen unter Mitarbeitern austausch- und kommunizierbar zu machen, Wissen zu teilen und zu verteilen, insbesondere aber auch Wissen als Unternehmensgut zu erweitern und vor allem anwendbar zu machen (Zaus 2002a, 2002b).
2.2.6 Wissensnutzung
Der fünfte und letzte Eckpfeiler des WIMALO ist die Wissensnutzung als Wachstumsmotor für die Wertschöpfung des Unternehmens, die ohne eine solides Wissensmarketing von vornherein zum Scheitern verurteilt wäre (Rode 2001). Es setzt sowohl multiattributive Wissensprofile für Kunden und Anbieter voraus, Positionierungsstrategien für Wissensangebote, Verfahren zur Einschätzung von Wissensgütern sowie eine effiziente Strukturierung und Koordination der Wissensmarketingressourcen, d.h. Ressourcen zur Wissensschaffung, Vermarktung und zur Sicherstellung der Vergütung. Was die Wertschöpfung anbelangt besteht Einigkeit darüber, dass sich diese durch die direkte Nutzung und damit einhergehender Gewinne des Wissenskapitals zeigt. Der Wert von Wissen besteht demzufolge darin, wie, wofür und mit welchem Gewinn ein Unternehmen sein Wissen nutzt. Einen abschätzbaren Wert erhält Wissen dann z.B. über den Multiplikatoreffekt seiner Verwendung, aufgrund dessen erst die Verwendung anderer Dinge ermöglicht wird (Richter 2001, Zaus 2002a).
Zusammenfassend sei hervorgehoben, dass in der WIMALO-Konzeption alle Eckpfeiler zusammen weder eine Hierarchie noch einen hintereinander geschalteten Zyklus bilden, sondern ein Netzwerk mit der zentralen und integrierenden Verarbeitungseinheit der Wissenserzeugung. Zum Beispiel kann der Wissenserwerb mit der Wissenserzeugung und der Wissensrepräsentation zyklisch zu einem bidirektionalen Workflow verbunden werden. Analoges gilt für die Vernetzung von Wissenserzeugung, Wissensumwandlung und Wissensnutzung. Jeder Eckpfeiler ist mit jedem verbunden und wird über den der Wissenserzeugung integriert, da hier die Methoden und Techniken des vernetzten Denkens operativ umgesetzt und integriert werden. Herkömmlichen Wissensmanagementkonzeptionen fehlt es an einer solchen zentralen Verarbeitungseinheit, die kognitionswissenschaftlich fundiert und motiviert ist, da sie gewissermaßen das ,,Gehirn’’ für die Koordination von Wissenserwerb und Wissensrepräsentation sowie für Wissensumwandlung und Wissensnutzung verkörpert. Der Vorteil des WIMALO liegt eindeutig darin, dass es die Bildung straffer Organisationsstrukturen für feste oder virtuelle Teams sowie für Pilotgruppen oder Task Forces zulässt. Stellt man zudem die Tatsache in Rechnung, dass im Wissensmanagement jedes Team eine lernende Organisation ist, wird offensichtlich, dass die WIMALO-Konzeption sukzessiv in einem Unternehmen abteilungsintern aufgebaut werden kann und sich anschließend abteilungsübergreifend weiterentwickeln kann.
2.3 Communities of Learning and Practice (CoPs)
Anders als im Wissensmanagement als lernende Organisation, das über fünf Verarbeitungseinheiten funktional vernetzt ist, werden CoPs i.d.R. durch sogenannte Life-Cycles gekennzeichnet, die in charakteristische Phasen unterteilt sind. Da CoPs durch die Initiative engagierter Mitarbeiter ins Leben gerufen werden und dementsprechend von hoher intrinsischer Motivation abhängen, sind sie schwer über eine top-down Anordnung realisierbar. Sie dienen primär einem relativ offenen, informellen und weitestgehend selbstorganiserten Wissensaustausch im Rahmen eines vielschichtigen Netzwerkes von Mitgliedern mit gleichen oder ähnlich gelagerten Interessen (Schönherr 2002, Wenger 1999). Der Lebenszyklus einer CoP kann in fünf Phasen unterteilt werden, die zugleich die Entwicklungsstadien für nachhaltiges Bestehen sind:
1) Gründungsphase: Entstehung informeller Zusammenschlüsse von Mitarbeitern
2) Aufbauphase: Selbstbestimmung und Artikulation zugrunde liegender Annahmen
3) Anlaufphase: Intitialisierung erster Schritte und Verbesserung interner Kommunikation
4) Aktivphase: Alle Community Mitglieder nutzen die Vorteile gemeinsamer Arbeit
5) Adaptationsphase: Das gesamte Unternehmen nutzt den Output der Communities
Vom Standpunkt der Organisationspsychologie sind CoPs vergleichbar mit sich verfestigenden und kollektiv lernenden Interessengemeinschaften. Generell gilt, dass es in einem Unternehmen keine einzelne CoP gibt, sondern mehrere mit spezifischen Interessenschwerpunkten. So besehen handelt es sich also um eine Gemeinschaft von Interessengemeinschaften. Jede nutzt dabei eine für sie praktikable Kommunikationsform, die anlog zu Coffee Hour Runden, Jour fix Zusammenkünften, Dialogrunden, informellen Kolloquien, Stammtischrunden oder ähnlichen ``Social Event Settings’’ aufgebaut ist. Mittels unterstützender Technologien sind derartige Kommunikationsformen auch virtuell als Online-CoPs auf- und ausbaubar (Gronau 2002, Kim 2000).
2.3.1 Basisfunktion einer Community of Learning and Practice
Die jeweils praktizierte Kommunikationsform (z.B. Knowlede Cafè oder Best Practice Stammtisch) ist indessen keineswegs beliebiger Art, da jede Phase des Lebenszyklus einer CoP bestimmte Basisfunktionen, Verhaltenskodizes und Zielsetzungen beinhaltet. In der Gründungsphase beinhaltet die Basisfunktion u.a. den Aufbau von Beziehungen zwecks Bildung einer Interessengemeinschaft. In der Aufbauphase erfolgt des weiteren die Schaffung einer gemeinsamen Interessenbasis mit klar definierten Zielen über Austausch und Vermittlung von Best Practices in Bezug auf Verfahrensweisen, Fakten und Werten. In der Anlaufphase beinhaltet die Basisfunktion, den Zugang zur CoP zu erleichtern, die Kontaktpflege auszubauen und Lernprozesse in Gang zu setzen. Erst in der Aktivphase kommt es zur eigentlichen Zusammenarbeit, indem ein nachhaltiger Wissensaustausch ausgeübt wird, der in der Adaptationsphase dann nutzen- und gewinnbringend für Unternehmensziele umgesetzt wird (Schönherr 2002).
2.3.2 Ziel und Schwerpunkt einer Community of Learning and Practice
Was in einer CoP an Wissen ausgetauscht wird, sind nicht etwa Wissensaspekte über Einzelaktivitäten oder punktuelle Fähig- und Fertigkeiten, sondern umfassendere Best Practices, z.B. wie komplexe Handlungsabläufe bewerkstelligt werden, wie und in welcher Weise ein bestimmtes Projekt geplant und strategisch aufgebaut werden kann, wie und mit welchen Mitteln eine Abteilung mit welchen Zielen umstrukturiert werden kann oder wie Workflowmanagement und Produkt-Daten-Management integriert werden können, um nur einige Beispiele zu nennen. M.a.W., nicht einzelne Spielzüge, sondern die Spielstrategie steht im Vordergrund des Wissensaustausches, nicht wie die Ernte eingefahren wird, sondern wie der Hof als Ganzes optimal geführt wird, nicht Lehreinheiten, sondern das Lehren als ganzheitlicher und konstruktiver Prozess, nicht Lerneinheiten, sondern Lernfelder und die Einbindung des Lernenden in dieses Lernfeld zwecks Förderung seiner emotionalen, sozialen und praktischen Intelligenz stehen im Vordergrund. An Hand dieser Beispiele wird deutlich, dass CoPs primär bewährtes Erfahrungswissen austauschen und es zum gegenseitigen Vorteil ihrer Mitglieder in Umlauf bringen.
Die Botschaft einer CoP ist somit klar, es geht um den Austausch von Handlungskompetenzen, um sie so effektiv und effizient wie möglich in der eigenen Aufgabenumgebung einsetzen zu können. Es geht um Wissensumwandlung im Allgemeinen und im Besonderen, und genau hier überschneiden sich nicht nur die WIMALO- und CoP-Konzeptionen, sondern praktisch alle Wissensmanagementkonzeptionen, denn keine kommt an der Wissensumwandlung mit all ihren Methoden und Techniken vorbei. Wenn es eine Börse für Best Practices gäbe, würden die Knowledge Broker auf Aktien der Wissensumwandlung setzen, denn sie ist der Wachstumsmotor für ,,Turning Knowledge into Cash’’.
3. Best Practices im Rahmen der Wissensumwandlung
In Abschnitt 2.2.5 wurde bereits darauf verwiesen, dass der Eckpfeiler Wissensumwandlung im Rahmen des Wissensmanagements als lernende Organisation von Nonaka & Takeuchis vier Formen zur Umwandlung unternehmensrelevanten Wissens ausgeht. Was Nonaka & Takeuchi jedoch hinsichtlich konnektionistischer Theorien und Modelle über adaptive Systeme übersehen haben, sind die ausgesprochen evolutionsstrategischen Implikationen ihrer Theorie zur Wissensschaffung. Dies ist insofern ein Vorteil, als sich diese Theorie vor dem Hintergrund von Rechenbergs Evolutionsstrategien, Holland’s Genetischen Algorithmen oder Zaus’ Autogenetischen Algorithmen zum Gegenstand von Selektion, Mutation, Rekombination und Evaluation machen lässt, d.h. bzgl. Auswahl phänotypischer Fitness von Wissen, Innovativer Veränderung von Wissen, Erzeugung von Wissensvielfalt und Prüfung des Wissens auf ökologische Validität, Reliabilität und Nutzen (Holland 1992, Nonaka & Takeuchi 1997, Rechenberg 1994, Zaus 1999). Die Details dazu würden ein völlig separates Paper erfordern, so dass wir die dahinter stehende Idee nur am Rande streifen können. Im Vordergrund steht stattdessen die Fragestellung, welche Best Practices mit den einzelnen Stadien der Wissensumwandlung konkret verbunden sind. Wir werden die Wissensumwandlung daher als eigenständiges Modul darstellen, so dass sie von Befürwortern der Community of Learning and Practice oder anderer Konzeptionen des Wissensmanagements ,,als Paket’’ zur weiteren Inspektion übernommen und für eigene Zwecke exploriert werden kann.
3.1 Wachstumsmotor Wissensumwandlung
Wissensumwandlung geschieht nicht um ihrer selbst Willen und ist daher keine l’art pour l’art. Vielmehr soll mit ihr die Wertschöpfung und das Wissenskapital im Unternehmen vorangetrieben und gesteigert werden. Damit sie als Wachstumsmotor ,,rund läuft’’ und wirksam angekurbelt werden kann, werden dazu vier Stadien miteinander gekoppelt. Nonaka & Takeuchi bezeichnen diese Stadien als Sozialisation, Externalisierung, Kombination und Internalisierung:
1) Sozialisation: Informeller Wissensaustausch von implizitem und stillschweigendem
Wissen
2) Externalisierung: Bedeutungsgenerierende Wissensexplikation von Implizit- zu Explizitwissen
3) Rekombination: Aggregation und Erzeugung von Vielfalt nutzbaren Explizitwissens
4) Internalisierung: Intensive Aneignung und Vertiefung von Explizit- und Implizitwissen
Alle vier Stadien lassen sich zyklisch vernetzen und durch die zentrale Verarbeitungseinheit der Wissenserzeugung koordinieren, wobei wiederum die Techniken des vernetzten Denkens zum Tragen kommen. Das Stadium der Kombination wurde in unserer Vorgehensweise durch Rekombination ersetzt, da Rekombinationen mehr hergeben als bloße Kombinationen. Als Beweis stehen uns dazu chromosomale Crossoveroperationen der Evolutionsgenetik Pate, die als formale Operationen künstlich nachbildbar sind. Rekombination schafft Vielfalt, d.h. im vorliegenden Fall also Wissensvielfalt.
Um zu sehen, dass im Hintergrund des Wachstumsmotors tatsächlich ein künstlicher Evolutionsprozess abläuft, muss man sich lediglich die zyklische Abfolge 1 > 2 > 3 > 4 > 1 der obigen Stadien vergegenwärtigen. So folgen auf Sozialisationsaktivitäten bestimmte Externalisierungsaktivitäten, gefolgt von bestimmten Rekombinationsaktivitäten, die ihrerseits bestimmte Internalisierungsaktivitäten ermöglichen und fördern, womit Sozialisierungsaktivitäten wiederum substanziell vertiefbar sind. Auf diese Weise wird implizites Wissen explizit, explizites Wissen erweiterbar und zum Gegenstand der Aneignung vertrauten wie routinierten Wissens, das wiederum interindividuell austauschbar ist, womit sich der Kreis schließt. Innerhalb eines Unternehmens ließen sich daraus überaus prosperierende und spannende Wissensmanagement-Projekte initiieren.
3.2 Best Practices zum Informellen Wissensaustausch (Sozialisation)
Sinn und Zweck der Sozialisation bestehen im Erreichen von Lernfortschritten, im Gewinnen von Sichten und Einsichten, im Kennenlernen von Erfolgs- und Misserfolgserlebnissen einschließlich deren Bewältigung, im Austausch und der Gewinnung neuer Ideen sowie in der Szenariobesprechung zwischen Mitarbeitern und Kunden. In praxi schüttelt man den Output dieser Aktivitäten nicht ,,einfach locker aus dem Ärmel’’, sondern sollte sie zu Disziplinen erheben. Vier Beispiele sollen dies verdeutlichen.
3.2.1 Lernen an realen und virtuellen Modellen
Hinter dieser Sozialisationsform steckt zum einen das bewährte Konzept vom ,,Meister und seinen Schülern’’, zum anderen aber auch neuere Vorgehensweisen aus dem Bereich des Case-based Reasoning. Letzteres beinhaltet den Nachvollzug erfolgreich gelöster Problemfälle, so als würde der Meister seinen Schülern oder die Expertin ihren Mitarbeitern eine ganze Palette von Musterlösungen von Problemen vorführen, die erfahrungsgemäß oft auftreten. Die Verbindung zur Community of Learning and Practice ist hier offensichtlich. Lernen am Modell ist sowohl in vivo als auch in vitro, d..h. virtuell mittels interaktiver Werkzeuge multimedialen, hypermedialen und elektronischen Lernens, erzielbar. Obwohl das lebensnahe face-to-face basierte Lernen am Modell niemals vernachlässigt werden darf, hat das virtuelle Lernen am Modell den Vorteil, dass sich Lernende die Problemlösung zig Mal vor Augen und Ohren führen können, um sie angemessen nachvollziehen zu können (Holzinger 2001, Zaus 2002a). Der Vorteil des lebensnahen und somit situativen Lernens am Modell liegt darin, dass es zugleich das Einüben von Briefing- und Debriefingtechniken gestattet, wie sie beispielsweise im Hochleistungs- und Extremesport erfolgen. Im Briefing wird ein Vorhaben auf den Punkt gebracht und jedem sein ``slot perfect behavior’’ klar gemacht, während im Debriefing kurz und bündig konstruktive ,,Manöverkritik’’ über das ausgeübt wird, was schief gelaufen ist. Hier gilt die Maxim, Fehlerwissen ist Verbesserungswissen.
3.2.2 Dialoge kultivieren
Fordert man die Teilnehmer einer Geschäftsitzung zu einem Dialog auf, so entartet dieser alsbald zu einem Disput (disputare = auseinander legen), und bald darauf zu einer überwiegend traditionellen Diskussion (discutare = zerschneiden). Warum? Weil sie nie erlernt haben, was ein Dialog (dia + logos = freier Fluss von Sinngebungen) ist und wozu er gut ist. Im Gegensatz zum Dialog ist die traditionelle Diskussion die ineffektivste Form von Gruppenarbeit und untergräbt nicht nur jegliche Lernprozesse, sondern spaltet die Beteiligten auch noch in scheinbare Gewinner und Verlierer. Dialoge kultivieren heißt ihre Grundmerkmale (z.B. gegenseitige Einsichtnahme), ihre Anforderungsmerkmale (z.B. die Kunst des Zuhörens, Aufhebung von Voreingenommenheiten) und ihre Förderungsmerkmale (z.B. kooperatives Denken, partizipatives Denken, Inkohärenzüberwindung) zu praktizieren. Gute Dialoge leben vom Wachstum gegenseitiger Einsichten und sterben durch die Infiltration kontraproduktiver Kräfte. Zu letzteren zählen u.a. zu wenig Zeit, keine Hilfsbereitschaft, mangelnde Achtung und Wertschätzung, mangelndes Vertrauen, mangelnde Unvoreingenommenheit, mangelndes Engagement, mangelnde geistige Beweglichkeit und mangelnde Selbsthinterfragung, kurzum alles, was auch eine kreative Ideenkonferenz ruinieren würde (siehe auch 3.2.4 Best Practice ,,Brainstorming’’). Wovon ein Dialog insbesondere lebt ist der gegenseitig verstärkte Austausch mentaler Karten, die mit Hilfe eines helfenden Begleiters zwecks Unterstützung kollektiver Aufmerksamkeit ,,durchwandert’’ und ,,durchlebt’’ werden (Senge 1994, Zaus 2002a).
3.2.3 Story Telling
Geschichten erzählen, Cartoons skizzieren, Legenden schildern oder Trade Secrets weiter geben spielen in jeder Wissensmanagementform eine zentrale Rolle für die Sozialisation (Nonaka & Takeuchi 1997, Weick 1985, Weick 1995). Wie Metaphern und Schemata haben Stories eine Reihe von Funktionen. Sie stehen für etwas und sind daher zweckorientiert. Insbesondere sollen sie nicht nur sinn-und bedeutungsstiftend sein, sondern auch eine Pointe haben, die unmittelbar handlungsanleitend ist. Story Telling fördert Erfolgs-, Fehler- und Verbesserungswissen durch das Herausfiltern von First Principles, Trade Secrets, Tricks, Faustregeln, Bootstrapping à la Münchhausen, Lebensweisheiten u.v.a. mehr.
Als konkretes Anwendungsbeispiel seien hier Stories zum Organizational Trouble Shooting genannt. Nahezu alle Archetypen organisatorischer Fehlentwicklungen wie Problemverschiebung, Erodierende Ziele, Fehlkorrekturen, Tragödie der Allmende, u.s.f. lassen sich in short stories mit cartoons einbetten und vermitteln so in kompakter Form Sicht und Einsicht in komplexe dynamische Prozesse, über die jeweils ganze Kapitel geschrieben werden könnten. Die Kunst des Story Tellings besteht darin, vielschichtige Komplexität in wenigen Worten als Kurzgeschichte darzustellen und die Pointe der Kurzgeschichte auf einen einzigen Satz zu komprimieren, der einen ``One-shot-only Lerneffekt’’ auslöst, zum Beispiel:
- Problemverschiebung: Symptomatische Lösungen stürzen Ihr Unternehmen auf Dauer in den Ruin.
- Erodierende Ziele: Die Senkung von Leistungsstandards treibt Sie zunächst in die Mittelmäßigkeit, und anschließend in Ermangelung von Kundenaufträgen in die Insolvenz.
- Fehlkorrekturen: Man entledige sich eines Problems durch kurzsichtige Korrigenda und handele sich langfristig das Elend durch ungeahnte Rückkopplungseffekte gleich packungsweise ein.
Auf diese Weise lassen sich annähernd 20 Fehlentwicklungsstrukturen in Betrieben, Organisationen oder Unternehmen auf den Punkt bringen (Zaus 2002a, 2002b).
3.2.4 Sanftes Brain Storming
Als vierte Aktivität der Sozialisation heben wir hier das Brainstorming in Ideenkonferenzen hervor und fragen, was hat Brainstorming mit Evolutionsgenetik zu tun? Die Antwort fällt denkbar einfach aus. Interaktives Brainstorming ist ein Prozess des Gebens und Nehmens. Es ist kein Bombardement von Geistesblitzen, die ein armer Assistent mit Mind Mapping an die Tafel kritzelt und sich dabei ,,einen Tennisarm holt’’. Metaphorisch gesprochen ähnelt interaktives Brainstorming Manfred Eigens makromolekularem Hyperzyklus. Polynukleotide erzeugen selbst Protoenzyme, die von kooperierenden Polynukleotiden zum Überleben benötigt werden und sodann als Gegenleistung ebenfalls Protoenzyme zurückgeben. Sie schließen so einen Vertrag zur Autokatalyse, die ihre Weiterentwicklung erst ermöglicht. In der Sozialpsychologie nennt man einen solchen Austausch einen ,,doppelten Interakt’’ als Keim für selbstorganisierendes Wachstum von Ideen und Ideenflüssen (Weick 1985).
Gute Ideenkonferenzen generieren tatsächlich Hyperzyklen, also Zyklen des Gebens und Nehmens in Zyklen des Gebens und Nehmens. In konventionellen Brainstormingsitzungen wird indessen oft übersehen, dass keine Kommunikationsform das kreative Denken mehr fördert als der Dialog. David Bohms Werke belegen dies nicht nur im Kontext naturwissenschaftlicher Entdeckungen, sondern auch hinsichtlich kollektiv entdeckenden Lernens (Bohm 1995, Senge 1996). Die Verknüpfung von Dialog und Ideenkonferenz ist deswegen so wichtig, weil beide jeweils Prozesse der Wissenserzeugung und Wissensumwandlung sind. Dialoge nehmen der Ideenkonferenz ihren notorischen Wettbewerbscharakter und ersetzen ``Competitiveness’’ durch die Schöpfung eines feinmaschigen Bedeutungsnetzwerkes, das zum Motor für kollektive Intelligenz und kollektives Wissen werden kann. Im Dialog ,,sieht der Langsame mehr’’, weil Langsamkeit in Form von ,,Zeitdehnungsdenken’’ hier eine Tugend ist. Im Dialog ist langsam schnell und wenig mehr. Wir denken stets schneller als wir lernen können, folglich geben wir dem Lernen im Dialog eine Chance. Herkömmliches Brainstorming wird aus dieser Betrachtungsweise zum sanften Brainstorming, das hochwertige Geistesgüter ohne lähmenden Erfolgsdruck hervorbringt.
3.3 Best Practices zur Wissensexplikation (Externalisierung)
Externalisierung, die Transformation impliziten, verborgenen und prozessualen Wissens in semantisch hochbedeutsame Wissensexplikate, ist der Schlüssel zur intersubjektiv nutzbaren Wissensschaffung und Wertschöpfung. In diesem Zusammenhang gehen wir weit über den Ansatz von Nonaka & Takeuchi hinaus, da wir mit deren Schlüssel das Tor zur praktisch realisierbaren Wissensschaffung durch Knowledge Mapping Techniken öffnen. Als First Principle kommt hier das Knowledge Mapping Prinzip zum Tragen: Mapping means Knowing. No knowledge, no map. No map, no cognitive guidance. No cognitive guidance, no intelligible behavior (Zaus 1999). Im Knowledge Mapping zeigt sich der Unterschied zwischen Kennen und Können. Nur wer wirklich weiß, worüber er spricht, kann dies auch in Form einer bedeutungstragenden Wissenslandkarte abbilden. Dabei sprechen wir nicht von ,,Landeskunde und Raumordnung’’, sondern von professioneller Wissenskartographierung, in deren Rahmen Wissen diagnostizierbar und auf ökologische Validität überprüfbar wird, damit es als Unternehmensgut einen monetären, materiellen oder ideellen Austauschwert aufweist. Wir unterscheiden konzeptuelle von prozeduralen und prozedurale von prozessualen Wissenslandkarten, d.h. rechnenden Karten, ohne uns die Möglichkeit zu nehmen, sie zu kombinieren oder für hybride Formen zu rekombinieren (Novak 1998, Sterman 2000, Zaus 1999, 2002a, 2002b).
3.3.1 Zum State-of-the-Art der Wissenskartographierung
Wissen zu kartieren heißt konkret, Techniken des vernetzten Denkens operativ umzusetzen. Aus Platzgründen können hier nicht alle in Frage kommenden Denktechniken näher umrissen werden, aber drei verdienen zumindest eine genauere Charakterisierung, und zwar visuelles, konzeptuelles und prozedurales Denken. Visuelles Denken ist als Fähigkeit ausgewiesen, einen Wissenssachverhalt mit Mitteln der Bild- und Wortsprache zu analysieren und nach Maßgabe eines vereinbarten Symbol- und Zeichenvorrats sichtbar zu machen. Konzeptuelles Denken ist indessen die Fähigkeit, zentrale Begriffe einer Wissensdomäne herauszustellen und die wesentlichsten Bedeutungszusammenhänge zwischen ihnen verbal benennen zu können sowie als begriffliches Navigationsnetzwerk darstellen zu können. Prozedurales Denken ist darüber hinaus die Fähigkeit, eine durch ständige Übung oder Erfahrung erworbene Fähig- und Fertigkeit, die scheinbar regellos als implizites Wissen im Gedächtnis gespeichert wurde, durch ein eindeutig nachvollziehbares Handlungsablaufschema explizit zu machen, d.h. durch einen kristallklaren Workflow repräsentieren zu können. Was aus diesen Denktechniken hervorgeht sind Concept Maps und Decision & Process Maps. Insgesamt gesehen kommen als Best Practices der Wissenskartographierung folgende Mapping Techniken in Frage:
- Mind Mapping (Aufgrund dessen beschränkter Tauglichkeit nicht weiter betrachtet)
- Concept Mapping (für Begriffsbildungsnetzwerke zur Explikation deklarativen Wissens)
- Decision- & Process Mapping (für Workflows zur Explikation prozeduralen Wissens)
- Causal Loop Mapping (für Kausalnetzwerke mit positiver und negativer Rückkopplung)
- Fuzzy Cognitive Mapping (für mehrwertige Kausalnetzwerke als Prädiktorsysteme)
- Stock & Flow Mapping (für rückgekoppelte Bestands- und Flussgrößennetzwerke)
- Functional Flow Mapping (für rückgekoppelte Berechnungs- und Simulationsnetzwerke)
- HyperMapping (für modulare Repräsentationen von Netzwerken in Netzwerken)
- HyperWebbing (für die Vernetzung von Netzwerken untereinander)
- Hybrid Mapping (für rekombinierte, d.h. gekreuzte und multifunktionale Netzwerke)
Die Details zu diesen Wissenskartierungstechniken füllen de facto einen 300 Seiten Atlas, der für das Wissensmanagement als lernende Organisation in Vorbereitung ist (Zaus 2002a). Wir beschränken uns im Folgenden auf drei herausragende Techniken.
3.3.2 Concept Mapping
Concept Mapping beinhaltet die Abbildung von Implizit- und Explizitwissen in multirelationale Digraphen, d.h. in Netzwerke, deren Knoten konkrete Begriffe enthalten und deren gerichtete Kanten bedeutsame, verbal ausgedrückte Beziehungen zwischen den Begriffen tragen. Das Resultat ist eine Concept Map, die im Gegensatz zu einer Mind Map einer sorgfältigen begrifflichen Analyse in Bezug auf ihre ökologische Validität unterzogen werden kann. Im Gegensatz zu einer Mind Map kann eine Concept Map auch einer rigorosen mathematischen Analyse unterzogen werden, da sie isomorph als Adjazenzmatrix repräsentierbar ist, die ihrerseits für Evaluationszwecke in eine Bewertungsmatrix oder in eine Look-up Table transformiert werden kann (Zaus 2002a). Concept Mapping ist im Vergleich zu allen übrigen Mapping Techniken ein Faktotum, d.h. eine universelle Kartierungstechnik, mit welcher nicht nur alle übrigen Kartierungstechniken beschreibbar und erklärbar sind, sondern mit welcher implizites und explizites Wissen sichtbar, verständlich, nachvollziehbar und über Intranets oder das Internet austauschbar und nutzbar gemacht werden kann. Das Institute for Human and Machine Cognition (IHMC, Florida) verfügte im Jahr 2002 allein für den Sektor Concept Mapping Applications über ein effektives Research Funding Volumen von 21 Mio.USD, womit das Potenzial dieser Technik für ,,Turning Knowledge in Cash’’ hinreichend belegt sein dürfte.
Abgesehen von seiner herausragenden Rolle als Lehr- und Lerninstrument in Schul-, Hochschul- und Weiterbildungsbereichen spielt Concept Mapping aufgrund seiner universellen Einsatzmöglichkeiten eine zunehmend größere Bedeutung als strategisches Instrument im Wissensmanagement von Wirtschaft und Industrie, da es sich hervorragend dazu eignet, Geschäftskonzeptionen von Abteilungen transparent zu machen, Marketingstrategien zu visualisieren, Trainings- und Fortbildungsprogramme zu strukturieren, Produkt-Daten-Management zu dokumentieren und mit Workflowmangement zu koppeln, Leistungslandkarten für KMUs oder Abteilungen großer Unternehmen zu entwickeln, Wissensmarketing bezüglich all seiner erforderlichen Ressourcen zu kartieren sowie Metaphern, Schemata und Analogien in allen erforderlichen Details zu elaborieren. Die Anwendungsmöglichkeiten des Concept Mappings sind praktisch unbegrenzt. Rechnergestütztes Concept Mapping wird von verschiedenen Software Produkten ermöglicht, zum Beispiel Inspiration Version 7.0 (siehe www.inspiration.com).Von den Autoren wird Concept Mapping in Forschung und Lehre, in Wissens- und Workflowmanagement sowie in Marktforschung und Markenentwicklung mit großem Erfolg eingesetzt (Marten & Zaus 2002, Zaus 2002a, 2002b).
3.3.3 Decision & Process Mapping
Decision & Process Mapping beinhaltet die Abbildung impliziten Handlungswissens, damit dieses explizit und fehlerfrei nachvollziehbar wird, um es sich anschließend als implizites Wissen über das Stadium der Internalisierung anzueignen. Im Gegensatz zu Mind Maps und Concept Maps sind Decision & Process Maps visualisierte Handlungsalgorithmen. Die dazu verwendete Mapping Technik baut auf den allseits bekannten Flussdiagrammen auf, die 1946 von Henry Goldstine und von John von Neumann eingeführt wurden, erweitert diese aber in vielfacher Hinsicht zwecks Berücksichtigung paralleler Handlungsabläufe in Workflows und parallel verschachtelter Handlungsabläufe, wie sie in Hochleistungsteams abzuwickeln sind. Als Beispiele seien hier Teams der Chirurgie, Boxen-Teams der Formel 1, Teams in Concurrent Engineering und Design oder interaktive Arbeitsabläufe in alltäglichen Praxisfeldern wie in der Gastronomie, Kfz-Werkstätten oder Arztpraxen genannt.
Im Zusammenhang mit Concept Maps spielen Decision & Process Maps eine zentrale Rolle für das Workflowmanagement, da mittels Concept Maps Aktivitäten und die damit verbundenen Aufgaben bis zu den einzelnen Aktionen hinunter präzise kartographiert werden können, und die Aufgaben- und Aktionsebene mittels Decision & Process Mapping dynamisiert werden kann, so dass am Schluss ein Workflow visualisiert wird, der alle notwendigen Handlungsstrukturblöcke, Entscheidungsbedingungen und Verzweigungsalternativen für den erfolgreichen Abschluss der Handlungssequenz enthält. Diese hybride Form von Concept Maps und Decision Maps vereint deklaratives Faktenwissen mit prozeduralem Handlungswissen zu einem Workflow mit einer konvexen Mischung aus Implizit- und Explizitwissen, die prozessuales Wissen minutiös und leicht nachvollziehbar repräsentiert (Marten & Zaus 2002, Zaus 2002a).
Rechnergestütztes Decison & Process Mapping wird u.a. durch die Software Produkte SmartDraw Version 6.0 (siehe www.smartdraw.com) oder Inspiration Version 7.0 (siehe Abschnitt 3.3.2) ermöglicht, deren Preis-Leistungsverhältnis ausgesprochen gut ist. Ein Überblick zu einschlägigen Software Produkten wird in Zaus (2002a) aufgeführt.
3.3.4 Stock & Flow Mapping
Die dritte und letzte Mapping Technik, die wir im Rahmen der Externalisierung als Best Practice vorstellen, betrifft das Stock & Flow Mapping, in dessen Rahmen die Wechselwirkung zwischen Stock- bzw. Bestandsgrößen und Flow- bzw. Flussgrößen abgebildet wird. De facto werden über diese Technik Rückkopplungssysteme n-ter Ordnung kartographiert. Wie Fuzzy Cognitive Maps, die wir aus Platzgründen nur kurz in Abschnitt 3.4.2 erwähnen (siehe Zaus 1999), sind Stock & Flow Maps rechnende Karten, also Computational Maps. Sie lassen sich mit geeigneter Software auf dem Rechner implementieren und machen die Dynamik zwischen den einbezogenen Bestands- und Flussgrößen über Behavior-over Time Graphs berechenbar, so dass die Veränderungen der Wirkungsgrößen über die Zeit erkennbar werden. Mathematisch gesehen visualisieren Stock & Flow Maps Differential- und Integralgleichungen, die für Modelle über Wachstumsmotoren unentbehrlich sind (Sterman 2000, Zaus 2002a).
Was Stock & Flow Maps insbesondere transparent machen, sind die Bedingungen, unter welchen Wachstum möglich oder unmöglich wird. Dies führt uns zu einem weiteren First Principle , dem so genannten Wachstumsprinzip: Wachstum erzielt man durch Ausbremsen seiner Bremser (Rode 2001, Senge et al. 2000, Zaus 2002a). Hinter diesem Prinzip steht die Erfahrung, dass es wenig Sinn macht, die an einem sich abschwächenden Verstärkungszyklus direkt beteiligten Einflussgrößen ,,zu pushen’’, sondern sich vielmehr um diejenigen Einflussgrößen zu kümmern, die teils direkt oder teils indirekt das Wachstum der direkt Beteiligten unterminieren. Im übertragenden Sinne bedeutet dies, sich hinhaltender Hinderer zu entledigen oder sie zumindest zu neutralisieren, damit das Wachstum wieder angekurbelt werden kann. Stock & Flow Maps werden von den Autoren für das Projektmanagement sowie für die Ableitung von Workflows in der zielgerichteten Interaktionsoptimierung in KMUs angewandt, wobei insbesondere leicht nachvollziehbare Handsimulationen benutzt werden (Marten & Zaus 2002, Zaus 2002a).
Zusammenfassend sei herausgestellt, dass Stock & Flow Mapping insbesondere Projektplanung, Projektmanagement, die Entwicklung und Überwachung von Wachstumsmotoren, die Bestimmung von Bestands- und Flussgrößen über die Zeit sowie die Antizipation unerwünschter Konsequenzen im Rahmen eines Wachstumsprozesses zu repräsentieren und analysieren gestattet, wobei dies über Hand- oder Computersimulationen vertieft werden kann (Sterman 2000, Zaus 2002a).
3.4 Best Practices der Wissensvermehrung (Kombination & Rekombination)
Wissensvermehrung fußt auf einer ,,ars combinatoria’’, mit der sich der Scholastiker Raymundus Lullus in seiner ars magna und der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz in seiner characteristica universalis bereits auseinandersetzten. Beiden ging es um Wissens- und Erkenntnisgewinnung, indem durch verschiedenartige Kombinationen neue Begriffe hervorgingen. In unserem Kontext geht es um die Kombination und Rekombination von Knowledge Maps. Dazu ist folgender Hintergrund nützlich.
Knowledge Mapping ist als Kartographierungstechnik eine streng funktionale Disziplin und beinhaltet die Aufgabe, Wissen über etwas für jemanden zum Zweck der optimalen Orientierung und effizienten Handlungsfähigkeit abzubilden. Die besondere Art des Wissens bestimmt dabei die Technik der Abbildung, denn mit einer Mind Map kann man kein Rückkopplungssystem n-ter Ordnung abbilden und gleichzeitig dessen Funktionsweise ablesen. Wissen über Fakten und Sachverhalte, also deklaratives Wissen, wird anders abgebildet als Wissen über Handlungen und Handlungsprozesse. Wissen über Ursachen- und Wirkungszusammenhänge, also Kausalwissen, wird anders abgebildet als deklaratives Faktenwissen oder prozedurales Handlungswissen. Wissen über das Zusammenwirken und die gegenseitige Beeinflussung von Bestands- und Flussgrößen, also systemtheoretisches Wissen, wird anders abgebildet als alle zuvor genannten Wissensarten. An Hand dieser vier Wissensdomänen (Fakten-, Handlungs-, Kausal- und Systemtheoretisches Wissen) wird ersichtlich, dass wir Wissen nicht von vornherein durch eine einzige Kartierungstechnik abbilden können, sondern eine Art ,,ars combinatoria’’ bemühen müssen.
3.4.1 Kombinierte Wissenslandkarten
Wenn gleichartige Dinge kombiniert werden, z.B. zwei Concept Maps, so erhalten wir durch deren Zusammensetzung eine neue Concept Map mit entsprechender Wissensvermehrung. Wenn also z.B. zwei Experten ihre Concept Maps über mögliche Ressourcen zum Wissensmarketing entwickeln, so werden beide sicherlich unterschiedlich ausfallen. Kraft der Regel ``Two Brains are better than One’’ wird insgesamt mehr Wissen auf den Tisch kommen als durch einen Experten. Andererseits können wir auch eine Concept Map mit einer Stock & Flow Map kombinieren, indem wir in der Concept Map z.B. alle zentralen Begriffe der Stock & Flow Map erklären, so dass dem Endnutzer ein solides Wissen vermittelt wird, was in die Stock & Flow Map an konkreten Bestands- und Flussgrößen eingeht. Die Kombination von Wissenslandkarten ist folglich ein bewährter Weg zur effektiven Wissensvermehrung. An dieser Stelle verweisen wir unsere Leser auf die Liste der Knowledge Mapping Techniken in Abschnitt 3.3.1, damit sie sich ein Bild darüber machen können, welches Anwendungspotenzial die Kombination von Knowledge Maps für eine produktive und möglicherweise potenzierende Wissensvermehrung besitzt (Zaus 2002a).
3.4.2 Rekombinierte Wissenslandkarten
Wenn ungleichartige Dinge entstehen sollen, erhalten wir eine Mischform, die durch Artenkreuzung bzw. Rekombination entsteht. Worin liegt der Vorteil? Die Antwort lautet: Multifunktionalität, und das bedeutet mehrere Zwecke zugleich erfüllen. Rekombinierte Knowledge Maps können zum Vorteil und Nutzen des Endusers Fakten- und Handlungs- und Prozesswissen vermitteln, eben das, was Praktiker in der Praxis benötigen, weil Know-What, Know-How und Know-When integriert werden. William of Ockham’s Razor, das Sparsamkeitsprinzip von Abschnitt 2.2.1, kommt hierbei zum Tragen. In rekombinierten Wissenslandkarten werden alle daran beteiligten Karten zu einer Hypermap integriert, zu Karten in einer Karte mit unterschiedlichen Funktionalitäten.
Eine zweite Form der Rekombination ergibt sich, wenn z.B. eine Fuzzy Cognitive Map mit einer Stock & Flow Map rekombiniert wird. Worin liegt hier der Vorteil? Er liegt in der Vergleichsmöglichkeit, was diese Maps als rechnende Karten leisten. Auf diese Weise kann ein und dieselbe Problematik durch zwei unterschiedliche Berechnungsverfahren transparent gemacht werden. Die Fuzzy Cognitive Map dient dabei als Prädiktorsystem für Grenzzyklen n-ter Ordnung, d.h. für die Vorhersage von Fixpunkten, Oszillationen oder sich zyklisch wiederholender Ereignisfolgen, während die Stock & Flow Map die Zeitverlaufsgestalt der beteiligten Bestands- und Flussgrößen transparent macht. Der Fuzzy Cognitive Mapper weiß viele Dinge, welche die Stock & Flow Mapperin nicht kennt, und sie weiß viele Dinge, die er nicht kennt. Warum diese Inkommensurabilität von Wissen? Warum nicht das Wissen vermehren und mittels rekombinierter Wissenslandkarten ,,computational power tools’’ entwickeln, die transdisziplinär nutzbar sind? Im hier genannten Beispiel kommt bezüglich des vernetzten Denkens konzeptuelles Denken, nichtlineares Kausaldenken, fuzzy logisches Denken, dynamisches und strukturelles Denken sowie generisches Denken zur Anwendung. Es belegt dadurch nochmals das in Abschnitt 3.3 hervorgehobene Knowledge Mapping Prinzip, dessen Realisierung die Beherrschung vernetzten Denkens voraussetzt.
3.4.3 Von individuellen zu kollektiven Wissenslandkarten
Mind Maps sind radiale und hierarchisch verzweigte Inklusionsketten von Schlagwörtern und Begriffen. Sie lassen sich in Ermangelung ihrer formal logischen und mathematischen Grundlagen nicht ohne willkürliche Verzerrungen und Informationsverlusten in kollektive Wissensstrukturen transformieren. Dies kann kein guter Ausgangspunkt für die Vermehrung von Wissen sein, denn wenn interindividuelles Wissen nicht strukturierbar und repräsentierbar ist, bleibt das Ganze individuelles Stückwerk. Anders verhält es sich dagegen mit Concept Maps, da sie isomorph als quadratische Matrizen repräsentierbar sind, deren Zellen die jeweils relationale(n) Bedeutung(en) enthalten und somit zu bewertbaren Wissensdokumenten erweiterbar sind. Zwei hinsichtlich ihrer Konzepte und Relationen nicht-konforme Concept Maps, die z.B. zwei Experten erzeugt haben, lassen sich aber stets durch expandierte Matrizen in eine gemeinsame Matrix transformieren, deren Rücktransformation sodann eine kollektive Concept Map ergibt. Aufgrund der multirelationalen Zusammenhänge ist dieses Verfahren zwar aufwendiger als zum Beispiel bei Fuzzy Cognitive Maps, da letztere exklusiv auf Kausalbeziehungen beruhen, aber die aus der Fuzzy Logik kommende Aggregationstechnik kann direkt auch für Concept Maps übernommen werden (Kosko 1997, Zaus 1999, 2000). Worin liegt der Vorteil? Aggregationstechniken dieser Art unterstützen eindeutig kooperative Lernprozesse, in deren Verlauf fragmentarische Concept Maps, die partielles Wissen reflektieren, zu umfangreichen und an Wissen reichhaltigen Concept Maps führen, schließlich geht es hier um die Erzeugung nutzbarer Wissensvielfalt. Die in jede Richtung reversible Transformation in strukturidentische Repräsentationsformen (Netzwerke = Matrizen = Look-up Tables = Protokolle) ist bislang bei der Entwicklung von Wissenslandkarten (sprich Leistungslandkarten, Kausalkarten, Kunden- und Anbieterkarten, u.s.f.) völlig unzureichend exploriert und genutzt worden.
3.5 Best Practices zur Wissensaneignung (Internalisierung)
Sinn und Zweck der Externalisierung und Rekombination ist die Bereitstellung expliziten Wissens, das über verschiedenste Wissenskartographierungstechniken für die persönliche Wissensaneignung aufbereitet wird. Die an diesem Prozess beteiligten Mitarbeiter erhalten nicht nur von anderen Kolleginnen und Kollegen derartige Wissensexplikate, sondern produzieren sie über Methoden und Techniken des vernetzten Denkens im Gegenzug auch selbst. An dieser Stelle greift als weiteres First Principle Heinz von Foersters Austauschprinzip. Ein interindividueller Wissensumwandlungsprozess kann nur dann funktionieren, wenn Kognition ihre eigenen Kognitionen durch die Kognitionen eines anderen erzeugt (v.Foerster 1999). Es ähnelt dem Prinzip vom reversiblen Geben und Nehmen im Dialog, der für sich genommen eine best practice der Wissensumwandlung ist (siehe Abschnitt 3.4.2).
Als best practices der Internalisierung haben sich erfahrungsgemäß Learning by doing, Learning while doing, Training-on-the-Job sowie Exorzieren und Exerzieren erwiesen, insoweit es die Internalisierung von Handlungswissen betrifft. Es beinhaltet das Studium von Decision & Process Maps und die Ausübung solcher Maps als Workflows in eigens dafür bestimmten Aufgabenumgebungen. Was die Internalisierung expliziten Fakten- und Sachverhaltswissen anbelangt, so erfolgt diese durch nichts besseres als praktiziertes vernetztes Denken, angewandtes Knowledge Mapping und Personal Mastery als Disziplin der Selbstführung und dem Beharren auf die Erreichung gemeinsam gesteckter Ziele. M.a.W., die Ausübung von Sozialisation, Externalisierung und Rekombination ist bereits ein Internalisierungsprozess, in welchem ``hard skills’’ und ``soft skills’’ erworben werden, wobei sich letztere auf die Sozialisation und adäquate Verhaltensweisen beziehen, die ganze Kapitel füllen, welche wir andernorts vorstellen werden (Marten & Zaus 2002, Zaus 2002a, Zaus & Marten 2002).
4. Zusammenfassung
Alles in allem haben wir für die Wissensumwandlung über das Wissensmanagement als Lernende Organisation oder als Community of Learning and Practice einen konkreten Bezugsrahmen hergestellt. Zur Umsetzung der Wissensumwandlung wurden insbesondere zehn Methoden und Techniken des vernetzten Denkens vorgeschlagen, die ihrerseits in zehn Knowledge Mapping Techniken konkret anwendbar sind und der Wissens- und Wertschöpfung eine solide Basis verleihen. Darüber hinaus wurden für die Schaffung von ``Excellence all over’’ eine Reihe von First Principles eingeblendet. Dazu zählten das Synergieprinzip, das Wertschöpfungsprinzip, das Paretoprinzip, Ockham’s Sparsamkeitsprinzip, das Maupertiusprinzip, das Knowledge Mapping Prinzip, das Wachstumsprinzip sowie das Austauschprinzip, die zusammengenommen wesentlich zur Realisierung unseres Leitsatzes ,,Turning Knowledge into Cash’’ beitragen.
Wir hoffen unsere Leser davon überzeugt zu haben, dass die von Ikujiro Nonaka und Hiorotaka Takeuchi initierte Konzeption der Wissensumwandlung durch die hier aufgeführten Best Practices substanziell erweitert worden ist und damit in Unternehmen programmatisch umsetzbar ist. Was wir für die zukünftige Weiterentwicklung für notwendig und wünschenswert halten, ist Wissensumwandlung als Evolution und Revolution, indem die in Abschnitt 3 angesprochene Operationalisierung über künstliche Evolutionsprozesse in Angriff genommen wird. Nicht im großen Wurf über Nacht, sondern nach dem Grundsatz ``Start small and let it grow.’’ In der Umsetzung schließen wir uns dem neunten hier vorgetragenen First Principle an, das wir im Sinne Albert Einsteins als ``Bounded Simplicity Principle’’ bezeichnen. Es lautet: ,,Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher.’’ Auch wenn es von Einstein als Scherz ausgesprochen wurde, hat es für das Wissensmanagement und die Wissensumwandlung eine doch bemerkenswert tiefere Bedeutung.
Literatur
Bohm, D. (1995) Unfolding Meaning. Foundation House, Loveland, Colorado
Davenport, T.H. & Prusak, L. (1998) Working Knowledge: How organizations manage what they know. Harvard Business School Press, Boston
Foerster, H.v. (1999) Sicht und Einsicht: Versuche zu einer operativen Erkenntnistheorie. Carl-Auer-System Verlag, Heidelberg
Gronau, N. (Hrsg.) (2002) Wissensmanagement: Strategien – Prozesse – Communities. Shaker Verlag, Aachen
Holland, J.H. (1992) Adaptation in Natural and Artificial Systems. MIT Press, Cambridge
Holzinger, A. (2001) Basiswissen Multimedia Band 2: Lernen. Vogel Buchverlag, Würzburg
Kim, A. J. (2000) Community Building on the Web. Peachpit Press, Berkeley CA
Kosko, B. (1997) Fuzzy Engineering. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J.
Lehner, F. (2000) Organisational Memory: Konzepte und Systeme für das organisatorische Lernen und das Wissensmanagement. Carl Hanser Verlag, München
Marten, U. & Zaus, M. (2002) Projekt ,,Zielgerichtete Interaktionsoptimierung in kleinen und mittleren Unternehmen’’. Brand & Value GmbH, Bremen, im Druck
Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1997) Die Organisation des Wissens: Wie japanische Unternehmen eine brachliegende Ressource nutzbar machen. Campus Verlag, Frankfurt/Main – NewYork
Novak, J. (1998) Learning, Creating, and Using Knowledge: Concept Maps as Facilitative Tools in Schools and Corporations. Lawrence Erlbaum, Mahaw
Probst,G., Romhardt, K., Raub, St. (1997) Wissen managen – Wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optimal nutzen. Gabler, Wiesbaden
Rechenberg, I. (1994) Evolutionsstrategie ´94: Werkstatt Bionik und Eveolutionsgenetik Band I. frommann-holzboog, Stuttgart – Bad Cannstatt
Richmond, B. (1993) Systems thinking: Critical thinking skills for the 1990s and beyond. Systems Dynamics Review 9(2), 113-134
Richter, M.M. (2001) Knowledge Management als zentrale Unternehmensaufgabe. INRECA-Center, Universität Kaiserslautern.
Rode, N. (2001) Wissensmarketing: Strategische Entscheidungsoptionen für Anbieter von Wissen. Gabler, Wiesbaden
Schönherr, M. (2002) Technologische Unterstützung von Knowledge Communities. In: Gronau, N. (Hrsg.) (2002) Wissensmanagement: Strategien – Prozesse – Communities. Shaker Verlag, Aachen
Senge, P.M. (1994) The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. Doubleday, New York
Senge, P.M., Kleiner, A., Smith, B., Roberts, Ch. & Ross, R. (Hrsg.) (1996) Das Fieldbook zur Fünften Disziplin. Klett-Cotta, Stuttgart
Senge, P.M., Kleiner,A., Roberts, Ch., Roth, G. & Smith, B (Hrsg.) (2000) The Dance of Change: Die 10 Herausforderungen tiefgreifender Veränderungen in Organisationen, Signum Verlag, Wien
Sterman, J.D. (2000) Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Irvin-McGraw-Hill, Boston
Vester, F. (2000) Die Kunst vernetzt zu denken: Ideen und Werkzeuge für einen neuen Umgang mit Komplexität. DVA, Stuttgart
Weick, K.E. (1985) Der Prozess des Organisierens (The Social Psychology of Organizing). Suhrkamp, Frankfurt/Main
Weick, K.E. (1995) Sensemaking in Organizations. Sage Publications, Thousand Oaks – London
Wenger, E. (1999) Communities of Practice, Cambridge University Press, Boston
Zaus, M. (1999) Crisp and Soft Computing with Hypercubical Calculus: New Approaches to Modeling in Cognitive Science and Technology with Parity Logic, Fuzzy Logic, and Evolutionary Computing. Physica-Verlag/Springer Verlag, Heidelberg – New York
Zaus, M. (2000) Fuzzy Cognitive Maps: Kausale Prädiktorsysteme in den Wirtschafts-, Sozial-, Politik-, Gesundheits- und Verhaltenswissenschaften. AFN Norddeutschland, ISBN 3-89720-438-X
Zaus, M. (2002a) Atlas zum Wissensmanagement als Lernende Organisation. Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg, FB 5 Psychologie, In Vorbereitung
Zaus, M . (2002b) Memorandum zu Wissenskartographierungstechniken und Werkzeugen für das Wissensmanagement. Technical Report, Carl-von Ossietzky Universität Oldenburg. FB 5 Psychologie
Zaus, M. & Marten, U. (2002) Wachstumsmotor – Templates für die Optimierung zielgerichteter Interaktionsprozesse in kleinen und mittleren Unternehmen. Brand & Value GmbH, Bremen, im Druck







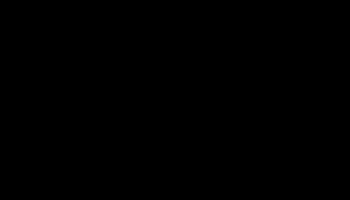
Unser Verständnis |
| Unsere Methodik |
| semantic design™ |
| Der Weg |
| Das Ziel |